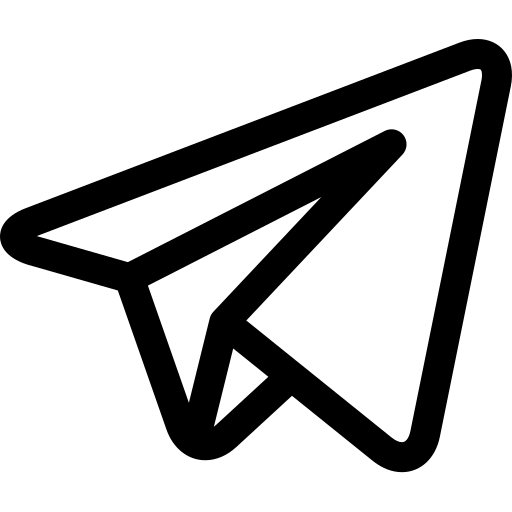👀Insider-Infos, Misserfolg
Hoi
👀 Eine Ankündigung, meine Insider-Infos, die Empathie Initiative begleitet Restrukturierungsprozesse, unser momentaner Misserfolg und warum wir darüber schreiben – darum geht es heute.

Ich war dabei, als das allererste Jahrestraining in Empathie und Konfliktlösung stattfand – Jahre vor der Gründung von Empathie Stadt Zürich. Damals war ich 19 und meine Mutter hat mich und meinen Vater zu dem Kurs mitgenommen. Wir waren acht Teilnehmende, darunter auch Livio Lunin.* Mein Name ist Vinh Tran.
*Livio ist der heutige Haupttrainer der Empathie Initiative
Heute schreibe ich zum ersten Mal einen Newsletter für die Empathie Initiative. Ich war dabei, als das allererste Jahrestraining in Empathie und Konfliktlösung stattfand – Jahre vor der Gründung von Empathie Stadt Zürich. Damals war ich 19 und meine Mutter hat mich und meinen Vater zu dem Kurs mitgenommen. Wir waren acht Teilnehmende, darunter auch Livio Lunin. Mein Name ist Vinh Tran.
Ich schreibe aus der Perspektive einer Person, die nicht im Kernteam ist, aber seit langem mithilft und darum Insider-Infos teilen kann. Aus meiner Perspektive erzähle ich, wie die Empathie Initiative in die Begleitung von Restrukturierungsprozessen hineingerutscht ist. Das sind keine Insider-Infos im Sinne von Geheimnissen, es ist eher so, dass wir uns an so vielen Ecken und Enden entwickeln, dass wir nicht dazu kommen, über alles zu berichten. Ich finde es aber sinnvoll, wenn diese Seite unserer Arbeit sichtbarer wird (u.a. weil sie mich begeistert). Darum mache ich einen ersten Schritt mit diesem Newsletter.
Zuerst aber noch eine Ankündigung: Es ist ein Essay am Entstehen, in dem die Theorien des Wandels von Marshall Rosenberg, Joanna Macy und Mahatma Gandhi verglichen werden. Ausserdem wird darin behandelt, was die Empathie Initiative konkret zur Förderung der Demokratie beiträgt. Zweiteres fassbar zu beschreiben, ist schon länger fällig, es dauert aber noch etwas. Ich hoffe, ihr habt Geduld – falls nicht, schicke ich Empathie für die Ungeduld. <3
Ganz am Schluss schreibe ich, wie gesagt, über unseren Misserfolg.
Weil es unser Verständnis ist, dass Auseinandersetzungen nicht nur auf der zwischenmenschlichen Ebene stattfinden, sondern dass sie ebenfalls Ausdruck ungeeigneter Systeme sind, begannen wir damit zu experimentieren, Konflikte als Informationsquellen zu nutzen, um die Systeme von Organisationen oder Gruppen anzupassen.

Ich werde nun beschreiben, nach welchem Ansatz wir vorgehen, wenn wir Gruppen, Organisationen und Institutionen beraten und ein paar Anstösse geben, wie ihr mit diesem Ansatz experimentieren könnt.
Wie ist die Empathie Initiative in Restrukturierungsprozesse hineingerutscht?
Seit den Anfängen gehört es zu unserem Projekt, dass wir Konfliktgespräche mediieren – im Privaten, im Arbeitskontext, im Aktivismus und in der Politik. Weil es unser Verständnis ist, dass Auseinandersetzungen nicht nur auf der zwischenmenschlichen Ebene stattfinden, sondern dass sie ebenfalls Ausdruck ungeeigneter Systeme sind*, begannen wir damit zu experimentieren, Konflikte als Informationsquellen zu nutzen, um die Systeme von Organisationen oder Gruppen anzupassen. Diese Herangehensweise hat sich als so hilfreich erwiesen, dass wir schliesslich in die Begleitung umfangreicher Restrukturierungsprozesse hineingerutscht sind.
Ich werde nun beschreiben, nach welchem Ansatz wir vorgehen, wenn wir Gruppen, Organisationen und Institutionen beraten und ein paar Anstösse geben, wie ihr mit diesem Ansatz experimentieren könnt.
Ein Mitglied unseres Beirats, Miki Kashtan, eine international tätige Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation, beschreibt, dass in jeder wirkungsfähigen Gruppe, Organisation oder Institution fünf grundlegende Systeme vorhanden sind: Feedbackfluss, Ressourcenfluss, Informationsfluss, Entscheidungssystem und Konfliktsystem.** Dieser Ansatz überzeugt uns. Wenn wir also für eine Konfliktmediation oder eine Weiterbildung angefragt werden, entwickeln wir häufig Veränderungsvorschläge für eines oder mehrere dieser Systeme.
Wie geht ihr vor, wenn ihr an Systemen arbeitet?
Ich habe euch hier eine Übersicht über die Systeme mit dazugehörigen Fragen zusammengestellt, die ihr euch in euren Teams und Gruppen stellen könnt, wenn ihr an euren Systemen arbeitet:
- Feedbackfluss: Welche Anpassungen braucht das System, damit Feedback so fliessen kann, dass gemeinsames Lernen erfolgt (anstatt dass Feedback entweder verbale Attacken oder aber «nettes» Schweigen beinhaltet, was beides nicht zu Wachstum beiträgt)?
- Ressourcenfluss: Welche Anpassungen braucht das System, damit Ressourcen – nicht nur monetäre, sondern auch körperliche und emotionale – so verteilt werden, dass alle genug haben und niemand ausbrennt?
- Informationsfluss: Welche Anpassungen braucht das System, damit Informationen transparent und klar verteilt werden, ohne dass der Informationsfluss unübersichtlich oder überwältigend wird?
- Entscheidungssystem: Welche Anpassungen braucht das System, damit Entscheidungen so getroffen werden, dass möglichst viel Expertise und viele Bedürfnisse integriert werden, ohne dass endlose Diskussionen den Entscheidungsprozess zermürben?
- Konfliktsystem: Welche Anpassungen braucht das System, damit angeknackstes Vertrauen wieder aufgebaut und Konflikte als Feedback für die Anpassung der anderen Systeme verwendet werden kann? Miki Kashtan beschreibt es so: «All the shit that doesn’t get treated in the other systems gets composted in the conflict system.»
Es mag nach einem grossen Aufwand klingen, an all diesen Punkten gleichzeitig zu arbeiten. Darum folgt nun eine Idee für einen ersten Schritt.
* Ich spreche hier nicht nur von Gesellschaftssystemen, sondern auch von Systemen auf der Ebene von Organisationen oder Gruppen. In diesem Newsletter fokussiere ich allerdings auf Systeme auf der Ebene von Organisationen oder Gruppen. Hier könnt ihr mehr von Tanja Walliser über die Ebene der Gesellschaftssysteme und wie diese unseren Alltag beeinflussen nachlesen und hier ist ein Essay über die Gewalt in der Welt
** https://thefearlessheart.org/item/organizational-systems-overview-packet/

Auch wenn steile Informations- und Entscheidungshierarchien beibehalten werden, kann bereits ein grosser Unterschied in der Zusammenarbeit bewirkt werden, wenn minutiös geklärt wird, wer die Verantwortung und Entscheidungsmacht über welche Aufgaben hat und wo die für diese Aufgaben relevanten Informationen zur Verfügung stehen.
Was könnte ein erster Schritt sein, um die Systeme einer Organisation oder Gruppe zu verfeinern?
Es kann bereits viel Wirksamkeit in eine Organisation oder eine Gruppe zurückkehren, wenn lediglich der Informationsfluss und das Entscheidungssystem überarbeitet werden. Besonders, wenn Irritationen dieser Form gehört werden, könnte das ein Hinweis dafür sein, dass eines dieser beiden Systeme ein Update braucht:
- Warum hat mir das niemand gesagt? Ich hätte das wissen müssen! (Ungünstige Wissenshierarchien)
- Weil du mir X nicht früher gesagt hast, habe ich die Arbeit so gemacht, wie sie dir jetzt nicht passt. (Unklarheit im Timing des Informationsflusses)
- Meine Bedürfnisse wurden in diesem Entscheid mal wieder nicht berücksichtigt! (Machtlosigkeit in steilen Hierarchien)
- Immer die gleichen drei Leute entscheiden, wo’s lang geht. (Implizite Machtausübung in flachen Hierarchien)
- Ich weiss auch nicht, warum niemand etwas unternimmt. Meine Verantwortung ist es jedenfalls nicht. (Verantwortungsdiffusion)
Die ersten beiden Punkte weisen darauf hin, dass es an der Zeit ist, den Informationsfluss zu überarbeiten, die letzten drei sind Zeichen dafür, dass das Entscheidungssystem angepasst werden könnte. Hier klärende Schritte einzuleiten, kann bereits sehr viel verändern.
Obwohl wir als Empathie Initiative dazu tendieren, einen möglichst transparenten Informationsfluss und möglichst flache Entscheidungshierarchien zu entwickeln – weil wir an diese Art der Zusammenarbeit glauben – arbeiten wir auch mit Organisationen und Institutionen, die für diesen Schritt nicht bereit sind. Wir haben beobachtet, dass auch wenn steile Informations- und Entscheidungs-Hierarchien beibehalten werden, bereits ein grosser Unterschied in der Zusammenarbeit bewirkt werden kann, wenn minutiös geklärt wird:
- Wer die Verantwortung und Entscheidungsmacht über welche Aufgaben hat (Entscheidungssystem)
- Wo die für diese Aufgaben relevanten Informationen zur Verfügung stehen (Informationsfluss)
Müssen wir unsere Systeme immer anpassen, wenn Konflikte aufkommen?
Selbstverständlich nicht. Es kann auch sein, dass die Systeme bleiben, wie sie sind und die Personen sich anpassen.
Als ich mir die obenstehende Frage gestellt habe, kam mir eine Erinnerung an eine Begleitung eines aktivistischen Kollektivs durch die Empathie Initiative. Dieses Kollektiv hatte sich seit seiner Gründung für das Konsent-Prinzip* als Teil des Entscheidungssystems entschieden, während aber ein neues Mitglied diese Form der Entscheidungsfindung kritisierte und ein Mehrheitsprinzip** einführen wollte. Daraus entstand ein langwieriger Konflikt, der sich über mehrere Sitzungen der Gruppe ausdehnte. Schliesslich wurde eine Trainerin der Empathie Initiative eingeladen, um zu unterstützen. Sie stellte folgende Frage: «Ist die Akzeptanz des Konsent-Prinzips ein Selektionskriterium für den Einstieg in euer Kollektiv oder ist es ein Prinzip, das ihr mit jedem neuen Mitglied diskutieren wollt?»
In Organisationen und Gruppen, in denen alle Mitglieder aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligt sind, ist besondere Klarheit darüber notwendig, welche Teile des Systems (z. B. Prozesse, Werte oder Visionen) grundlegend*** sind und welche stetig angepasst werden können. Diese Klarheit hilft, Entscheidungen gezielt zu treffen, ohne das Fundament der Organisation oder Gruppe zu untergraben.**** Wenn keine grundlegenden Elemente festgelegt werden, kann es vorkommen, dass dadurch Wirkungsfähigkeit verloren geht, weil bei jeder Sitzung alles aufs Neue auf den Kopf gestellt werden kann. Es kann dann passieren, dass die Gruppe beginnt, sich um sich selbst zu drehen, anstatt nach aussen zu wirken.
Die Beantwortung der von uns gestellten Frage hat grossen Einfluss auf die Entwicklung des Kollektivs. Wenn Personen erst nach dem Beitritt gefragt werden, ob sie das Konsent-Prinzip als Teil des Entscheidungssystems akzeptieren, sind sie bereits volle Mitglieder mit Entscheidungsmacht und können mit Berechtigung einen Prozess in Gang setzen, mit der Absicht, dieses System zu ändern. Wenn neue Mitglieder, aber bereits vor dem Beitritt gefragt werden, ob sie das Entscheidungssystem akzeptieren, haben sie lediglich die Macht zu entscheiden, ob sie aufgrund ihrer Antwort dem Kollektiv beitreten wollen oder nicht. Wenn sie aber eintreten, akzeptieren sie damit das Konsent-Prinzip.
Zurück zur Frage, ob wir Organisationen und Gruppen immer darin unterstützen, ihre Systeme anzupassen, wenn Konflikte auftreten. Die Begleitung dieses aktivistischen Kollektivs ist ein Beispiel, in dem der Konflikt zur Beibehaltung des Entscheidungssystems geführt hat und sich auf der Ebene der Personen etwas verändert hat. Die von uns gestellten Fragen haben einen klärenden Prozess in Gang gesetzt, in dem vom Kollektiv definiert wurde, dass das Konsent-Prinzip ein Selektionskriterium für den Beitritt ins Kollektiv ist. Die neue Person hat darauf das Kollektiv verlassen.
Ist es ein Misserfolg, wenn eine Person eine Organisation oder Gruppe verlässt?
Dazu zwei Gedanken:
- Selbstverständlich gilt nicht: Entweder es müssen Systeme verändert werden oder Personen verlassen die Gruppe. Im erwähnten Beispiel hätte es auch sein können, dass die Person sich entscheidet, das Konsent-Prinzip zu akzeptieren und Wege zu finden, im Kollektiv zu bleiben. Auch das hätte ein Szenario dargestellt, in dem als Antwort auf einen Konflikt keine Systemanpassung, sondern eine interne Umorientierung auf der Ebene der Personen stattgefunden hätte.
- Auch wenn eine Person eine Gruppe verlässt, sehen wir das nicht als Misserfolg. Im Gegenteil, Kommen und Gehen ist Teil des Lebens. Grenzen zu setzen oder sich umzuorientieren, sind wertvolle Ressourcen. Krampfhaft aneinander anhaften ist hingegen eher lebensfremd.
Apropos Misserfolg, ich wollte ja noch von einem Rückschlag der Empathie Initiative berichten. Dazu komme ich gleich. Ich möchte euch zuerst noch einladen, unsere Begleitung für Kollektive, NGOs, Parteien oder Institutionen zu erleben. Auf dem Button unten könnt ihr uns für eine Weiterbildung oder Prozessbegleitung buchen.
* Das Konsent-Prinzip ist eine partizipative Entscheidungsfindung, bei der alle Beteiligten mitreden können. Es ermöglicht Entscheidungen, solange es keine schwerwiegenden Einwände gibt. Im Gegensatz zum Konsens, bei dem alle zustimmen müssen, reicht hier das Fehlen substantieller Einwände für das Treffen eines Entscheids.
** Das Mehrheitsprinzip ist ein Entscheidungsprinzip, bei dem nicht alle zustimmen müssen, damit eine Entscheidung getroffen werden kann. Es reicht für einen Entscheid, wenn eine definierte Mehrheit dafür ist.
***Grundlegend bedeutet nicht unveränderbar. Um grundlegende Veränderungen anzustellen, erachte ich es allerdings als hilfreich, dass spezifische Prozesse definiert werden, die weniger häufig und systematischer ablaufen als alltägliche Entscheide einer Organisation oder Gruppe.
**** Sich solche Fragen zu stellen, ist besonders relevant für Organisationen und Gruppen, die sich basisdemokratisch organisieren, weil der Mitentscheidungsgrad derart hoch ist.

Anstatt nun die Schuldigen zu suchen, die sich diesen «schlechten» Plan ausgedacht haben – was in vielen Konflikten geschieht, die wir mediieren, wenn ein Misserfolg im Raum steht – konzentrieren wir uns auf das, was gut funktioniert und lernen aus dem, was nicht geklappt hat.
Was ist euer Misserfolg und warum schreibt ihr darüber?
Als ich anfing, den Newsletter zu schreiben, habe ich mir zuerst überlegt, es zu verheimlichen, dass die Gründung von Empathie Stadt Zug vielleicht scheitert. Kennt ihr das, dass ihr nur das erzählen wollt, was gut läuft? (Ich attribuiere es auf die internalisierte Leistungsgesellschaft.) Der Entscheid, dass ich über die Schwierigkeiten in Zug berichte, wurde vom ganzen Kernteam der Empathie Initiative begrüsst. Wir wollen normalisieren, dass Projektarbeit nicht immer nur rosig ist. Es gehört dazu, dass Dinge nicht gelingen, die wir uns vornehmen. Ausserdem ist auch ein Misserfolg – genauso wie ein Konflikt – ein guter Moment zu lernen.
Was wir konkret erleben, ist folgendes: Vielleicht habt ihr es auf Instagram mitbekommen, die Empathie Stadt Winterthur startete am ersten Abend des Grundlagenkurses in Empathie und Konfliktlösung mit beinahe 40 Teilnehmenden. In diesem Monat folgen nun die Kurse in Biel, Aarau und Zug. In Biel haben wir acht Anmeldungen und in Aarau sechs, was uns freut. In Zug sind es im Moment lediglich drei und wir sind uns noch nicht sicher, ob wir den Kurs bei dieser geringen Teilnahmezahl durchführen. Die Gründung von Empathie Stadt Winterthur fühlt sich nach einem vollen Erfolg an, was wir über Empathie Stadt Bienne und Empathie Stadt Aarau denken, erzähle ich gleich. Empathie Stadt Zug könnte – für alle, die es sinnvoll finden, diese Kategorien zu verwenden – als Misserfolg verbucht werden.
Was lernt ihr aus diesen unterschiedlichen Gründungsgeschichten?
- In Winterthur wurde der Kurs von Nadine Geckert organisiert (danke!), die selbst in Winterthur in einem Gesewo Haus lebt. Sie organisierte uns nicht nur einen Raum, sie hat für uns einen Antrag für finanzielle Unterstützung bei der Gesewo eingereicht und wir haben eine Zusage bekommen. Zusätzlich konnten wir über den Gesewo Newsletter Leute einladen. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar. → Wir nehmen mit, dass das eine wunderbare Weise ist, wie wir «Empathie Städte» gründen können.
- In Aarau und Biel sieht es anders aus. Wir haben den ersten Grundlagenkurs in Empathie und Konfliktlösung ohne lokale Orga-Unterstützung geplant. Trotzdem haben wir ein paar Kontakte vor Ort, die uns grosszügig unterstützen.* Der Start verläuft ähnlich wie damals vor rund fünf Jahren, als ich in Zürich am allerersten Grundlagenkurs in Empathie und Konfliktlösung teilnahm. Das fühlt sich nostalgisch-schön an. → Daraus lernen wir, dass es für uns auch mit wenigen lokalen Kontakten möglich ist, ein Empathie-Projekt zu gründen, solange wir offen für einen Start im kleinen Rahmen sind.
- Und in Zug? Da kennen wir schlicht niemanden. Was im Nachhinein selbstevident erscheint, haben wir durch diesen Versuch gelernt. Die Gründung eines Projekts, ohne lokal verankerte Personen zu kennen, ist für uns schwierig. Anstatt nun die Schuldigen zu suchen, die sich diesen «schlechten» Plan ausgedacht haben – was in vielen Konflikten geschieht, die wir mediieren, wenn ein Misserfolg im Raum steht – konzentrieren wir uns auf das, was gut funktioniert und lernen aus dem, was nicht geklappt hat. → Wir gründen nur noch an Orten, an denen wir bereits ein lokales Netzwerk aufgebaut haben.
* zum Beispiel Sam Kocher und Nadja Schnetzler in Biel oder Personen aus dem Kantonsspital und dem Klima Streik in Aarau. Danke euch allen von Herzen.
→ Sam Kocher und Yumi Bieri ermöglichen uns eine Location in Biel im Haus Pour Bienne <3
→ Nadja Schnetzler hat übrigens mit Laurent Burst ein neues Buch über Zusammenarbeit im Flow geschrieben. Schaut’s euch an!

Was das für Empathie Stadt Zug bedeutet, das steht und fällt mit diesem Newsletter.
Was bedeutet das für Empathie Stadt Zug?
Das steht und fällt mit diesem Newsletter. Falls Lesende unter euch sind, denen etwas daran liegt, dass Empathie Stadt Zug zustande kommt, dann ladet euer Umfeld an den Kurs in Zug ein. Oder kommt selbst vorbei. Oder beides. Wenn sich die Anmeldezahl bis am 14. Oktober nicht verändert, kann es sein, dass wir den Kurs absagen und die Gründung von Empathie Stadt Zug hinauszögern, bis wir genug lokale Leute kennengelernt haben. Wir werden euch und vor allem die drei Angemeldeten auf dem Laufenden halten.
- Hier ist der Link für alle, die den Event in Zug mit ihrem Umfeld teilen wollen.
- Hier ist der Link (es ist derselbe Link 🤡) für alle, die sich an den ersten Grundlagenkurs in Empathie und Konfliktlösung in Zug anmelden wollen. Falls wir noch ein paar Teilnehmende finden, startet er am 21. Oktober.
- Tanja wurde ausserdem von der Zuger Zeitung zur Gründung interviewt. Hier könnt ihr den Artikel lesen.
Das war’s von mir. Ich hoffe, ihr habt die vielen Worte gut überstanden.
Viel Liebi
und liebi Grüess
E> Vinh
PS: Da wir uns nicht lange mit griesgrämig sein aufhalten, sondern – wie gesagt – aus unseren Misserfolgen lernen, habe ich noch eine letzte Insider-Info für euch. Wisst ihr, wo wir bereits einige Leute kennen und sogar schon mehrfach den Wunsch nach einer Empathie-Stadt-Gründung gehört haben?
PPS: 🥁🥁🥁 …
PPPS: … in Basel
PPPPS: EMPATHIE STADT B A S E> L, endlich! 🐉
PPPPPS: Hast du Lust zu unterstützen, wenn die Gründung in Basel stattfindet? Dann klicke hier. (Du verpflichtest dich zu nichts.)
PPPPPPS: Klicke hier, wenn du denkst: «Ich könnte vielleicht eine Person aus meinem Umfeld in Basel einladen.» (Du verpflichtest dich zu nichts.)
PPPPPPPS: Oder du kannst jetzt unterstützen, in dem du dein Netzwerk in Zug, Aarau oder Biel über die Kurse informierst. Wie gesagt, wir kennen noch nicht so viele (oder keine) Leute vor Ort. Es hilft und freut uns, wenn du über uns redest und Leute einlädst.
PPPPPPPPS: ♥
weitere Blogs und Essays
Normen-Brechen, Zugehörigkeit und Sicherheit vs. Freiheit und Authentizität, sE>ndung mit Flavien
Vernissage, Empathie Ausstellung, empathische Aktionskunst, Empathie Kritik
Gründung Empathie Stadt Bern, subversive Pause, Teamzuwachs, Elternsein